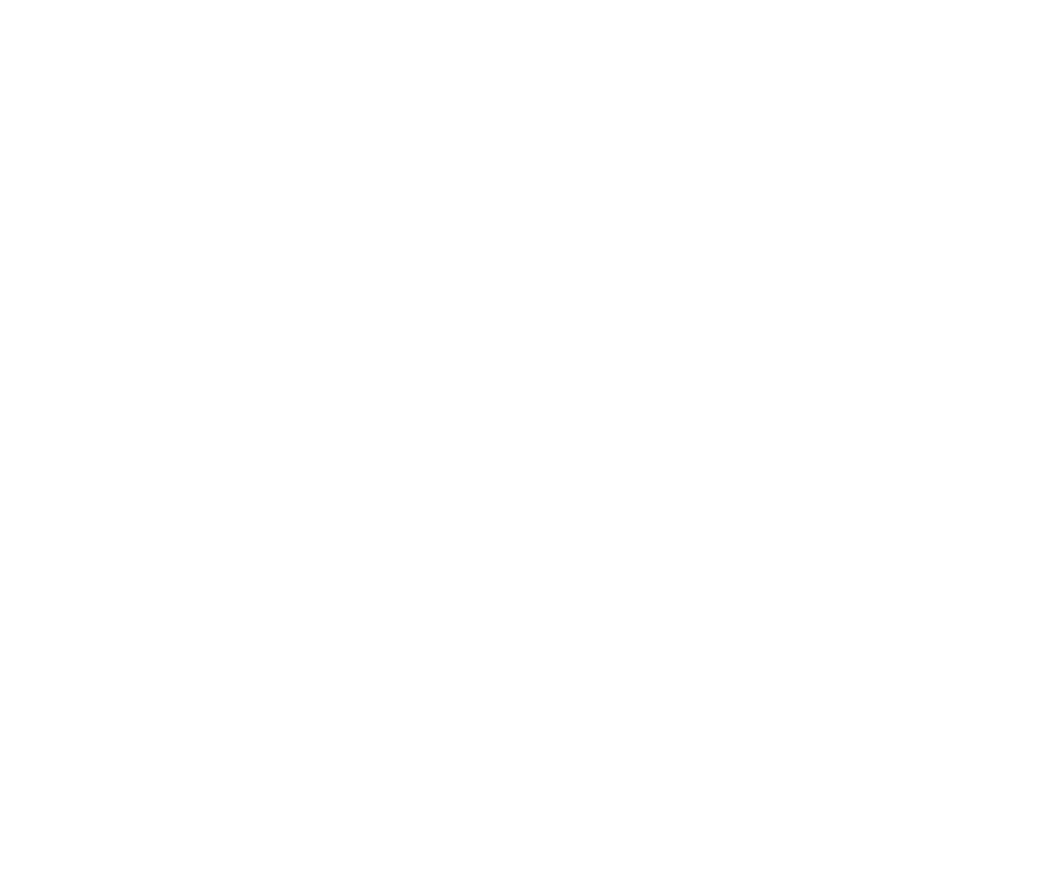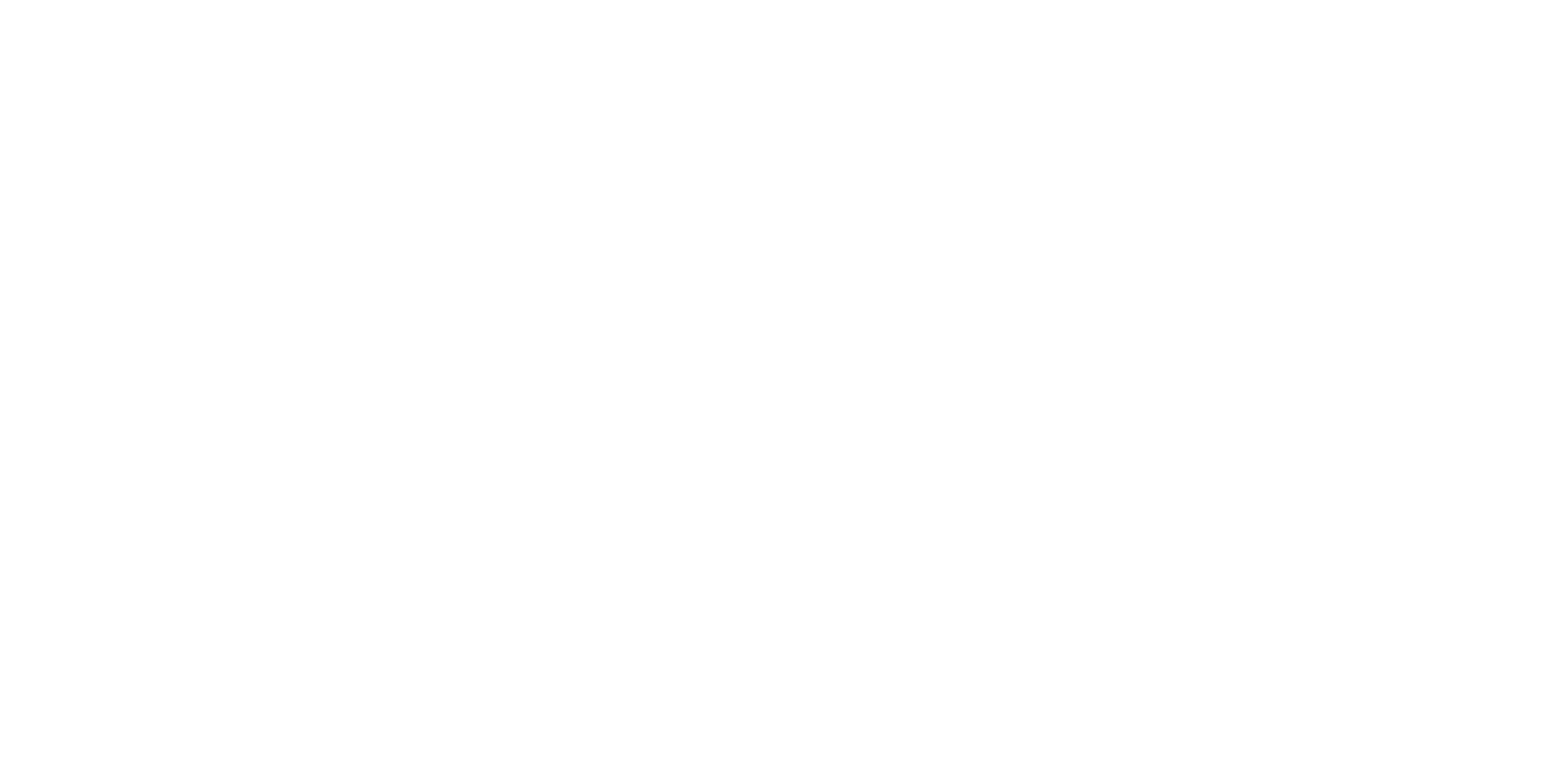AVOS-News
Schwache Herzen, starker Alltag?
Medizinisches Teamwork hilft bei Herzschwäche
Ein gutes Netzwerk ist für Patient*innen mit Herzinsuffizienz extrem wichtig. Vor allem, wenn es im Alltag der Betroffenen greift. Den Startschuss setzen Ärzt*innen hier mit der entsprechenden Überweisung – und helfen damit allen Beteiligten.
„Die meisten Patient*innen sind über unsere Hausbesuche und die angebotene Hilfe sehr erfreut”, erzählt Kardiomobil-Programmmanagerin Gerlinde Weiser-Sandhoff. Seit AVOS 2021 für das von den Sozialversicherungsträgern – allen voran der ÖGK – finanzierte Programm Kardiomobil Diplompfleger*innen direkt angestellt hat, läuft 2022 erneut eine umfangreiche Informationskampagne für Ärzt*innen, Care&Case-Manager*innen und Ordinationsassistent*innen. „Das sind unsere wichtigsten Partner*innen, die uns Betroffene zuweisen, bzw. Empfehlungen für die Zuweisungen aussprechen können”, sagt Weiser-Sandhoff und ergänzt: „Alleine heuer hat es im ersten Quartal schon mehr als 70 Zuweisungen gegeben, an denen auch niedergelassene Ärzt*innen stark beteiligt waren.“
„Ärzt*innen fehlt die Zeit, nötiges Wissen zu vermitteln“
Dementsprechend eng erfolgt die Abstimmung mit den Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen und niedergelassenen Ärzt*innen. Seitens des Kardiomobils werden laufend Besuchsprotokolle angefertigt und auch Telefonate mit Betroffenen zu Papier gebracht. Diese Protokolle werden ausgedruckt und den Patient*innen ausgehändigt, damit diese sie dann zu Kontrollterminen mitnehmen können. Prim. Priv– Doz. Dr. Johann Altenberger, der das Programm vor 19 Jahren ins Leben gerufen hat und seither dafür als Ärztlicher Leiter tätig ist, appelliert auch selbst immer wieder an seine Berufskolleg*innen, die Möglichkeit des Kardiomobils im Hinterkopf zu behalten: „Als Arzt, bzw. Ärztin kann man die Zeit nicht aufbringen, die nötig ist, um den Patient*innen mittels Schulungen und Beratungen das nötige Wissen zu deren eigener Krankheit zu vermitteln. Genau diesen Punkt decken die speziell ausgebildeten Diplompflegekräfte des Kardiomobils ab – eine Möglichkeit, die auch in Anspruch genommen werden soll.”
Drei direkte Termine und telefonische Beratungen
Neben der Zeitersparnis für die Mediziner*innen profitieren aber natürlich in erster Linie die Herzinsuffizienz-Patient*innen vom Programm Kardiomobil, in dem jeweils drei Termine à 1,5 Stunden in einem Zeitraum von drei Monaten vorgesehen sind. Darüber hinaus erfolgen neben dem Erstkontakt auch laufend telefonische Betreuungen und Beratungen – inklusive der Möglichkeit für Patient*innen, sich proaktiv zu melden. „Die Betroffenen sollen lernen, im Alltag möglichst gut mit ihrer Krankheit zurechtzukommen und einen geregelten Ablauf zu etablieren, der langfristig umgesetzt werden kann”, sagt Weiser-Sandhoff. Besonders wichtig sind der unkomplizierte und niederschwellige Zugang zu den Schulungen, die Beratungen in den eigenen vier Wänden und das regionale Betreuungsangebot für alle im Bundesland Salzburg lebenden Herzinsuffizienz-Patient*innen. „Wichtig ist dabei, dass auch pflegende Angehörige bei Bedarf geschult und beraten werden, um Win-Win-Situationen zu schaffen.”
„Krankheits-Management“ als moderndes Zauberwort
Insgesamt ist Herzinsuffizienz gut behandelbar, aber trotz hervorragender medizinischer Möglichkeiten oft mühsam und qualvoll für die Patient*innen. „Das reicht vom Einnehmen der Medikamente inklusive möglicher Nebenwirkungen über Ernährungstipps – natürlich abseits der Diätologie – bis hin zum Bewältigen des Alltags. „Das moderne Zauberwort heißt ‘Krankheits-Management’”, erzählt Weiser-Sandhoff. Besonders schwierig ist es dabei, die entsprechende Medikamenten-Dosis zu finden und zu vermitteln, dass diese – auch beim Auftreten von möglichen Nebenwirkungen – keinesfalls eigenmächtig abgesetzt werden darf. Teilweise müssen Tabletten auch geteilt werden, um die verordneten Milligramm nicht zu überschreiten. „Wer hier nicht aufpasst kann versehentlich überdosieren. Bei den Angaben auf den Packungen müssen die Betroffenen besonders genau sein – und auch bei ergänzenden Hinweisen von Apotheker*innen.”
Komplexe Erkrankung mit komplexer Medikation
Generell benötigt der Körper Zeit, um sich an die entsprechenden Medikamente zu gewöhnen. Wenn der erwünschte Medikamenten-Pegel erreicht ist – und vor allem auch über die Zeit – reduzieren sich auch mögliche Nebenwirkungen. „Die Patient*innen und deren Angehörige müssen verstehen, dass etwa gute Blutdruck-Werte durch die verordneten Medikamente entsprechend reguliert worden sind – und die Medikamenten-Einnahme weiter nötig ist, damit die Situation stabil bleibt”, so Weiser-Sandhoff. Auch, wie mit etwaigen Symptomen umzugehen ist und was sich noch in einem „normalen Rahmen” bewegt und bei welchen Anzeichen unverzüglich medizinische Hilfe angefordert werden soll, spielt eine zentrale Rolle in den Schulungen und Beratungen. „Es ist eine sehr komplexe Erkrankung mit komplexer Medikation, die von Haus aus mit einem niedrigen Blutdruck einhergeht”, sagt Dr, Altenberger. „Wir kämpfen ständig mit dem Medikations-Limit, das die Patient*innen verkraften. Bis hier eine entsprechend hohe Dosierung erreicht wird, sind sehr viel Engagement, Know-how und Zeit erforderlich – von den Betroffenen, von den betreuenden Ärzt*innen sowie natürlich auch vom AVOS-Diplompfleger*innen-Team.”
„Zuweisungen sind rasch ausgefüllt“
Die umfangreichen Beratungen der Kardiomobil-Pfleger*innen entlasten dabei auch die Ärzt*innen, deren Zeitkontingent häufig stark begrenzt ist. „Die Zuweisungen sind auf der AVOS-Homepage einfach zu finden und auch rasch ausgefüllt”, sagt Weiser-Sandhoff. Sobald diese inklusive Befund und Therapievorschlag vorliegen, können die AVOS-Expert*innen mit ihrer Arbeit loslegen. Dass das hervorragend funktioniert, lässt sich auch durch Studien belegen: „Neben wesentlich geringeren Zahlen bei den Rehospitalisierungen haben wir sogar die Sterblichkeitsrate gegenüber einer Kontrollgruppe, die nicht am Programm Kardiomobil teilgenommen hat, deutlich reduzieren können”, berichtet Dr. Altenberger. Darüber hinaus seien die Patient*innen, die im Programm betreut werden, wesentlich stabiler, was deren Komorbiditäten betrifft: „Mit einer Erhöhung der Awareness für die eigene Gesundheit lässt sich hier bereits früh entgegensteuern”, so der Primar. Und genau das deckt sich auch mit den vom Land Salzburg und den Krankenversicherungsträgern formulierten Salzburger Gesundheitszielen. Dort sind explizit folgende Punkte enthalten: „Gesundheitsförderliche Lebens- und Arbeitsbedingungen schaffen”, „die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung stärken” und „psychosoziale Gesundheit der Bevölkerung fördern”.
564 Patient*innen-Besuche alleine im Jahr 2021
Wie stark sich auch das Kardiomobil-Team selbst einsetzt, zeigen die Zahlen aus dem Jahr 2021: Hier sind hier im Rahmen des Programms 564 Besuche bei Patient*innen erfolgt. 129 davon sind im Flachgau abgewickelt worden, 180 in der Stadt Salzburg, 93 im Tennengau, 48 im Pongau, 18 im Lungau und 33 im Pinzgau. „Das zeigt, wie wichtig hier ein niederschwelliges Angebot auch abseits der Ballungszentren ist”, sagt Weiser-Sandhoff. Dabei sind insgesamt 261 Herzinsuffizienz-Patient*innen betreut worden, bei denen es im Schnitt je 2,16 Besuche gegeben hat. Hinzu kommen zusätzlich 233 Beratungsgespräche direkt in der Herzinsuffizienzambulanz der Salzburger Landeskliniken (SALK) und 569 telefonische Beratungen. Österreichweit sind etwa 250.000 Menschen von Herzschwäche betroffen. „Diese wird allerdings oft nicht ernst genommen und bloß als Altersschwäche abgetan”, weiß Weiser-Sandhoff. „Und genau hier kommen wieder die Ärzt*innen ins Spiel, deren Diagnose schwarz-auf-weiß von Betroffenen fast immer berücksichtigt wird.”

Mit nur wenigen Schritten und kaum Aufwand kann Herzinsuffizienz-Patient*innen dauerhaft geholfen werden. Und auch, wenn es sich um eine chronische Krankheit handelt, lässt sich hier durch entsprechende Beratung die Lebensqualität der Betroffenen deutlich steigern. Doch wie kommen die Patient*innen dazu?
Wenn Ärzt*innen eine Herzinsuffizienz feststellen, reichen bereits drei Schritte aus, um die Betroffenen in das Programm-Kardiomobil zu bringen:
- Die Erstzuweisung (PDF) aufrufen.
- Die Erstzuweisung downloaden und ausfüllen.
- Die ausgefüllte Erstzuweisung gemeinsam mit einem aktuellen Befund, der Datenschutzerklärung und einem Therapievorschlag an AVOS faxen (0662/887588-16).
Sollten wider erwarten nach den drei Besuchen der Kardiomobil-Expert*innen weiterer Schulungsbedarf bestehen, geht es mit drei Schritten auch zur Folgezuweisung:
- Die Folgezuweisung (PDF) aufrufen.
- Zu Folgezuweisung downloaden und ausfüllen.
- Die ausgefüllte Folgezuweisung gemeinsam mit einem aktuellen Befund und einem Therapievorschlag an AVOS faxen (0662/887588-16).
Alle weiteren Informationen zum Kardiomobil gibt es hier.
Mit dem Diplom in der Tasche können sich Pfleger*innen zu so genannten „Herzinsuffizienzberater*innen“ weiterbilden. Bei AVOS sind aktuell drei Kolleg*innen dabei, hier ihren Wissensstand ordentlich auszubauen. Die theoretische Ausbildung am AZW in Innsbruck insgesamt 176 Unterrichtseinheiten, die durch 40 Praxisstunden ergänzt werden. Neben der Theorie liegt demnach auch ein starker Fokus auf der Praxis.
Bei der Weiterbildung geht es unter anderem um die Symptomatik, Diagnostik und Therapie der Herzinsuffizienz. Zudem gibt es Unterrichtseinheiten zu pflegerelevanten Aspekten der Pathophysiologie, zu den Spätfolgen, dem Umgang mit telemedizinischen Einrichtungen und der Langzeitversorgung der Patient*innen.
„Das Feedback meiner Kolleg*innen ist durchgehend positiv“, erzählt Kardiomobil-Programmmanagerin Gerlinde Weiser-Sandhoff. „Auch, wenn der ein oder andere Kopf zwischendurch etwas ‚geraucht‘ hat, finden alle die Ausbildung top.“